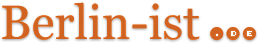„Im Anfang war das Wort“. (Ein Satz wie ein Felsen). „Rede mit mir“, bittet der fremdgängerische Mann seine Ehefrau. „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen!“, meint Goethes Direktor im „Faust I“. Widersprüchliches: Halte den Mund, aber gib mir Dein Wort. Thomas Gottschalk macht nun beides und beendet seine „Wetten das“-Laufbahn, die ja auch vor allem eine Lizenz zum Reden, zum Fragen enthielt.
Das Deutsche Theater veranstaltet seit geraumer Zeit die Gesprächsreihe „Gregor Gysi trifft Zeitgenossen“. Gysi und sein jeweiliger Gast präsentieren sich an ausgewählten Sonntagen um 11.00 auf der Bühne und reden miteinander. Zeugen dieses Gesprächs sind zwei, munter in einem Aquarium schwimmende, Goldfische und ein, in aller Regel, vollbesetzter Zuschauersaal. Gysi gibt hier nicht den Parteipolitiker, sondern nahezu ausschließlich den freundlichen, gut vorbereiteten Gastgeber, der sowohl dem Bühnenquartett, als auch dem Publikum das Gefühl vermittelt, einem besonderen Sonntagvormittag beizuwohnen. Auf der Bühne regiert die höfliche Distanz, die bohrende Frage, das nachdenkliche Gesicht, der übersprudelnde Mund, das phänomenale Gedächtnis, die überraschende Information, der gut erzählte Witz, die genuschelte Erklärung, die stumme Betroffenheit und manchmal ein reiches, im Zeitraffer erzähltes, Leben. Ein einziger Mensch steht hier im Mittelpunkt und ein anderer – jenseits aller Hektik – befragt ihn. Gysi hangelt sich mit seinen Fragen am Lebenslauf seines Partners entlang, besucht auch die Nebenstationen und hinterfragt Motive und Gefühle. Das ermöglicht Aufmerksamkeit, füllt die Bühne und beansprucht Kopf und Herz des Zuschauers hinreichend. Das Gespräch bringt ihn zum Staunen, Nachdenken, Lachen und entlässt ihn nach gut zwei Stunden verändert in den Tag.
Die Liste der bisher eingeladenen Gäste ist lang und vielsagend. Um nur einige zu nennen: Klaus Maria Brandauer, Kurt Maetzig, Peter Scholl-Latour, Wladimir Kaminer, Hape Kerkeling, Thomas Langhoff, Wolfgang Kohlhaase, Roger Willemsen und jüngst Mario Adorf. Besonders interessant war es immer dann, wenn dem Prominenten etwas entlockt werden konnte, was er nicht schon mal im Fernsehen von sich gegeben hat. Das gelingt oft gut, denn eine Kamera ist hier nicht dabei. Eine überproportionierte Selbstdarstellung musste man bei dieser Gesprächsreihe bisher selten erleben, aber auch sie gehöre dazu.
Die Veranstaltungen sind, wie nicht verwunderlich, lange vor dem Termin ausverkauft. Dass ich mit diesem Text die Karten-Chancen nicht gerade verbessere, liegt auf der Hand. Aber: Auf Qualität muss man hinweisen. Das nächste Gespräch findet am 27. März 2011 statt. (Eintritt: 8,- €uro) Gast ist der frühere sowjetische Botschafter (1971-78 in der BRD), Diplomat und jetzige Journalist Valentin Falin.