Als mir vor drei Jahren der Schauspielintendant der Wuppertaler Bühnen Christian von Treskow erzählt hat, dass er sich derzeit sehr für alles Kraurrockige interessiere, war mir dieses Interesse noch sehr fremd. Kraurock ist was für Ü50 Menschen dachte ich, doch als dann Jaki Liebezeit in Wuppertal spielte, hörte ich mich in dessen heutige Musik ein und wurde im Handumdrehen zum „Fan“. Als Ex-Drummer liegen die verdrehten und ungeraden Rhythmen des ehemaligen Can-Schlagzeugers natürlich voll auf meiner Wellenlänge und der in den 60er-Jahren geschulte Elektromusiker Burnt Friedmann bringt so viel Ideenreichtum mit, dass es gegenüber seinen technoiden 90er-Jahre Nachfolgern eine wahre Wonne ist.
Das Duo spielt am 15. Dezember wieder mal in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Schon letztes Jahr traten sie in der Volksbühne auf. Damals war es doch sehr meditativ und ruhig, wenn nicht schon einschläfernd. Besonders auch, weil die dazu gebeamten Videobilder so mitreißend waren, wie das ausgedehnte Betrachten einer blubbernden Lavalampe. Ich hoffe das wird diesmal etwas lebhafter visualisiert (oder gar nicht).
Ebenfalls dem Krautrock verpflichtet ist die kommende Ausstellung (ab 24. November) über die Band „Can“ im Künstlerhaus Bethanien. Wahrscheinlich ist die 50+ Generation inzwischen einfach als bestimmende Kuratoren-Generation angekommen und beschäftigt sich nun öffentlich mit der Aufarbeitung ihres jugendlichen Musikgeschmaks. Da sich dies derzeit gut mit gewissen, nerdigen Jugendvorlieben verbindet, scheint die Zeit reif dafür.
Im Allgemeinen empfehle ich zur gesamtgesellschaftlichen Krautrock-Einfinung diesen BBC-Film (auf englisch). Da lässt sich nachvollziehen, wie eine ganze Musikergeneration nach eigenständig deutschen, von der Vergangenheit unbelasteten Ansätzen suchte.




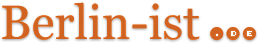
 Das war schon recht amusant, wie gestern Abend im Österreichischen Kulturforum bei der
Das war schon recht amusant, wie gestern Abend im Österreichischen Kulturforum bei der 