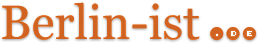Flughafen Tempelhof 2009 @LiAGeese
Ein „Memorieren im Schlendern“ nennt Walter Benjamin, der Autor des Passagenwerks, Franz Hessels 1929 erschienenes Buch Spazieren in Berlin. Wie Benjamin ist Hessel ein Flaneur und feinsinniger Beobachter, der kompromisslos subjektiv eine Stadt beschreibt, die nicht mehr und zugleich doch immer ist. Faszinierend, und selbst für intime Kenner der Berliner Stadtgeschichte lehrreich, sind dabei nicht nur seine liebevollen Beschreibungen des Alltags – Märkte, Mode, Manufakturen – und touristischer Highlights – Dom, Schloss, Dampferfahrt -, sondern die Parallelen, die sich, zwanzig Jahre nach dem Mauerfall, zum heutigen Berlingefühl ergeben.
Hessel erzählt von einer Stadt im Aufbruch, in der der Erste Weltkrieg Erinnerung zu werden beginnt, die boomt, die geprägt wird vom architektonischen Übergang von der Gründerzeit zur Moderne, in der „Groß-Cafés“ entstehen, und in der er Heldendenkmäler nur noch als hässliche Anachronismen wahrnehmen möchte. Zentrale Plätze ändern ihr Gesicht, das Scheunenviertel verschwindet, der Alexanderplatz entsteht, neben den Bauten Schinkels manifestieren die prächtigen „Tempel der Arbeit“, die Peter Behrens für Borsig und Siemens errichtet, die Metropole im Werden. Hessels Begeisterung für die urbane Dynamik und den Nonkonformismus, die auch das heutige Berlin wieder auszeichnen, stecken an. Gleichgültig ob man mit ihm über „die weite Fläche“ des Flughafens Tempelhof spaziert, den „alten Westen“ der Maaßen-, Derfflinger- und Kurfürstenstraße besucht, der „aus der Mode gekommen ist“, weil die Wohlhabenden „jetzt“ am Ku’damm und im Westend leben, oder „die Budenstadt eines Marktes“ ansteuert, „der das ganze Maybacher Ufer bedeckt“: Man kann sich der unbändigen Sehnsucht des Autors nach dem Bestehenden nicht entziehen.
Und doch sieht die Leserin heute natürlich auch die Vorboten des Grauens, das nur vier Jahre nach dem Erscheinen des Buches die Gesellschaft zu durchdringen begann und vor dem der Romancier, Lyriker und Rowohlt-Lektor Hessel am Ende selbst fliehen musste. Im Rückblick erschauert man, wenn man seinen Bericht über den Schöneberger Sportpalast liest: „Mit unparteiischem Echo dröhnen seine Wände ‚Hakenkreuz am Stahlhelm’ und ‚Auf zum letzten Gefechte’ wider wie die Zurufe der Sportfreunde. Es ist ja alles Überschwang derselben ungebrochenen Lebenslust.“
Wie rasch diese „Lebenslust“ bei den Nazis zur Mordlust wurde, spürte der 1880 geborene Sohn eines jüdischen Bankiers bald am eigenen Leib. Bis kurz vor den Novemberpogromen 1938 blieb er trotz Berufsverbots in Deutschland. Dann kehrte er – widerwillig – nach Paris zurück, wo er bereits während des Ersten Weltkriegs gelebt hatte. 1940 flieht er von dort vor der vorrückenden deutschen Wehrmacht ins südfranzösische Sanary-sur-Mer, wo er bald nach seiner Freilassung aus dem berüchtigten Internierungslager Les Milles, 1941 stirbt.
Im Geleitwort zur 2010 erschienenen Neuauflage des Buches seines Vaters schreibt Stéphane Hessel (Indignez-vous!): „Heute bin ich viele Jahre älter, als mein Vater gelebt hat. Mehr denn je scheint es mir nun notwendig, seine Botschaft weiter zu tragen. Jahr um Jahr kommt sie mir näher. Ohne sie, so erscheint es mir heute, können wir die bedrohliche, gefährliche, zerbrechliche Gesellschaft unserer Zeit nicht bewältigen. Aus der Erschütterung, die er nicht überlebte, trifft sein Lächeln mich tiefer als jeder Schrei.“
Franz Hessel formulierte eine eigene Botschaft speziell für die Berliner, denen er das Nachwort widmet: „Bisher wurde Berlin vielleicht wirklich nicht genug geliebt.“ Und er fordert seine Mitbürger auf: „Wir Berliner müssen unsere Stadt noch viel mehr – bewohnen“, was gar nicht so leicht sei „bei einer Stadt, die immerzu unterwegs, immer im Begriff ist, anders zu werden und nie in ihrem Gestern ausruht. … Wir wollen es [Berlin] … so lange anschauen, liebgewinnen und schön finden, bis es schön ist.“ Vielleicht wäre der Versuch, sich dieser Aufgabe anzunehmen, auch eine Form, das Gedenken an einen der vielen, die der Nationalsozialismus ins Exil und in den Tod trieb, wachzuhalten. Inspiriert von einem zauberhaften Buch, dessen Lektüre Vergänglichkeit ebenso wie die schönen Seiten vergangener Welten evoziert. Die Gegenwart birgt schließlich die Vergangenheit ebenso wie die Zukunft.