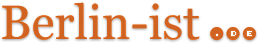18. November 2011 19:45:42
… Kurzkritik: „Poll“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die Schwiegermutter meines Onkels war Bäuerin und stammte aus Ostpreußen. Von ihr hörte ich, wenn es z. B. um die nie endende, öde Arbeit des Rübenverziehens ging, des öfteren das heute fast ausgestorbene Wort „marachen“ (schwer und schnell arbeiten). Sie sprach auch diesen so sehr gemütlich klingenden Dialekt, der dem Baltendeutsch ähnelt, das in dem Film „Poll“ immer wieder zu hören ist.
Die Handlung des Streifens, auf wahren Begebenheiten fußend, führt in das Estland des Jahres 1914 zurück – am Ende des Films hört der Zuschauer die Nachricht vom Ausbruch des 1. Weltkrieges. Regisseur Chris Kraus verknüpft in dieser Produktion familiäre Erkundungen – eine Hommage an Oda Schaefer (eine Großtante von Kraus und heute völlig vergessene Lyrikerin) – mit einem historischen Exkurs in das bis 1918 zu Russland gehörende Estland (Baltikum). Beides wird mit einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zwischen der blutjungen, aus besserem – zudem deutsch sprechendem – Hause stammenden, Oda und einem baltischen Anarchisten (Tambet Tuisk), der gegen die Russen kämpft, angereichert.
Edgar Selge spielt den Vater von Oda, der als abgeschobener Pathologie-Professor einen feinfühligen, aber auch ambivalenten Charakter (Selge spielt nicht zum ersten Mal einen solchen Typ) verkörpert. Jeanette Hain tritt als dessen Ehegattin, die ein leidenschaftliches Verhältnis mit dem Hofverwalter (Richy Müller – sehr einprägsam) pflegt und Oda’s Mutter, in Erscheinung. Die wirklichen Entdeckungen dieses Films, der auch auf kleine Schock- und Horroreinlagen (wozu die Pathologie geradezu einlädt) nicht verzichtet, sind jedoch das wunderbar kraftvolle und gleichzeitig sensible Spiel der Laiendarstellerin Paula Beer als junge Oda, zweitens der Drehort, mit dem ins Wasser gebauten, wunderlichen und unheimlichen Schlosshaus und schließlich die lichtvollen Bilder dieser Landschaft am Meer, welche uns die Kamera immer wieder vor Augen führt.
Der Film lief bereits im Februar 2011 in den Berliner Kinos, leider habe ich den Streifen seinerzeit verpasst. Wem es ebenso erging, kann sich die, seit einigen Tagen angebotene, DVD ausleihen. Unbefriedigend, zumindest auf meiner Film-Konserve, ist die teilweise schlechte Tonqualität. Man hört z. B. von den Dialogen am Beginn nur Genuschel. Also, entweder vorher mal reinhören oder bis zu einer TV-Ausstrahlung warten.